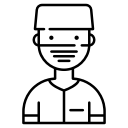Inhaltsverzeichnis:
- Entdecken Sie die Ursprünge des Stockholm-Syndroms
- Das Stockholm-Syndrom ist eine Form der Selbstverteidigung
- Stattdessen sympathisierte das Opfer mit dem Täter
- Typische Symptome des Stockholm-Syndroms
- Rehabilitationsbemühungen für Menschen mit Stockholm-Syndrom
Wenn Sie von seltsamen Fällen gehört haben, in denen das Entführungsopfer die Handlungen des Entführers bemitleidet, mochte oder sogar rechtfertigte, ist dies ein Beispiel für das Stockholm-Syndrom.
In letzter Zeit ist die Definition des Stockholm-Syndroms jedoch immer weiter gefasst worden. Umfasst nicht nur Fälle von Entführung, sondern erstreckt sich auch auf Fälle von Gewalt wie häusliche Gewalt und Gewalt beim Dating.
Entdecken Sie die Ursprünge des Stockholm-Syndroms
Stockholm-Syndrom Das Stockholm-Syndrom ist ein Begriff, der von einem Kriminologen und Psychiater, Nils Bejerot, geboren wurde. Bejerot verwendet es als Erklärung für die psychologischen Reaktionen der Geiselnehmer und die Gewalt.
Der Name Stockholm-Syndrom stammt aus einem Fall des Banküberfalls der Sveritges Kreditbank, der 1973 in Stockholm, Schweden, stattfand. Dieser Raub begann, als ein Team von Top-Kriminellen namens Jan-Erik Olsson und Clark Olofsson in die Bank eindrang und vier darin gefangene Bankangestellte als Geiseln nahm. Die Geiseln sind in einem Tresor eingesperrt (Gewölbe) für 131 Stunden oder ungefähr 6 Tage.
Aus polizeilichen Ermittlungsberichten geht hervor, dass die Opfer während ihrer Geiselnahme einer Vielzahl grausamer Behandlungen und Morddrohungen ausgesetzt waren. Wenn die Polizei jedoch versucht, mit den beiden Räubern zu verhandeln, helfen die vier Geiseln tatsächlich und geben Jan-Erik und Clark Ratschläge, die Polizei nicht aufzugeben.
Sie kritisierten sogar die Bemühungen der Polizei und der Regierung, gegenüber den Ansichten der beiden Räuber unempfindlich zu sein. Nachdem die beiden Mugger gefasst worden waren, weigerten sich die vier Geiseln auch, vor Gericht gegen Jan-Erik und Clark auszusagen.
Stattdessen behaupteten die Geiseln, die Räuber hätten ihr Leben zurückgegeben. Tatsächlich sagten sie sogar, sie hätten mehr Angst vor der Polizei als vor den beiden Räubern. Nicht weniger interessant, die einzige weibliche Geisel im Raub gestand ihre Liebe zu Jan-Erik, bis sie sich verlobten.
Seitdem sind ähnliche Fälle auch als Stockholm-Syndrom bekannt.
Das Stockholm-Syndrom ist eine Form der Selbstverteidigung
Das Stockholm-Syndrom oder Stockholm-Syndrom ist eine psychologische Reaktion, die durch Sympathie oder Zuneigung gekennzeichnet ist, die sich aus dem Entführungsopfer gegenüber dem Täter ergibt.
Das Stockholm-Syndrom erscheint als Selbstverteidigungsmechanismus, der vom Opfer bewusst oder unbewusst ausgeführt werden kann. Grundsätzlich führen Selbstverteidigungsreaktionen dazu, dass eine Person Verhaltensweisen oder Einstellungen zeigt, die im Widerspruch zu dem stehen, was sie tatsächlich fühlt oder tun sollte.
Dieser Selbstverteidigungsmechanismus wird ausschließlich vom Opfer durchgeführt, um sich vor Bedrohungen, traumatischen Ereignissen, Konflikten und verschiedenen negativen Gefühlen wie Stress, Angst, Angst, Scham oder Wut zu schützen.
Stattdessen sympathisierte das Opfer mit dem Täter
Wenn eine entführte Geisel oder ein Opfer häuslicher Gewalt in einer beängstigenden Situation festgehalten wird, wird das Opfer wütend, beschämt, traurig, ängstlich und ärgerlich über den Täter sein. Wenn Sie die Hauptlast dieser Gefühle jedoch lange genug tragen, ist das Opfer geistig erschöpft.
Infolgedessen beginnt das Opfer, einen Selbstverteidigungsmechanismus zu bilden, indem es eine Reaktion bildet, die völlig entgegengesetzt zu dem ist, was es tatsächlich fühlt oder tun sollte. Dann wird Angst zu Mitleid, Wut zu Liebe und Hass zu Solidarität.
Darüber hinaus sagten mehrere Experten, dass die Handlungen des Geiselnehmers, wie das Füttern oder das Lebenlassen des Opfers, als eine Form der Rettung interpretiert wurden.
Dies kann vorkommen, weil das Opfer das Gefühl hat, dass sein Leben bedroht ist. In der Zwischenzeit ist die einzige Person, die sich selbst retten und akzeptieren kann, der Täter selbst. Entweder durch das Essen, das der Täter gab, oder einfach durch das Überleben des Opfers.
Typische Symptome des Stockholm-Syndroms
Das Stockholm-Syndrom ist eine Störung. In der Tat sind sich Experten einig, dass dieser Zustand eine Form der ungesunden Beziehung ist.
Genau wie Gesundheitsprobleme im Allgemeinen zeigt auch das Stockholm-Syndrom Anzeichen oder Symptome. Die charakteristischsten Anzeichen und Symptome des Stockholm-Syndroms sind:
- Positive Gefühle gegenüber dem Entführer, Geiselnehmer oder Gewalttäter erzeugen.
- Die Entwicklung negativer Gefühle gegenüber Familienangehörigen, Verwandten, Behörden oder der Gemeinschaft, die versuchen, das Opfer vom Täter zu befreien oder zu retten.
- Zeigen Sie Unterstützung und Zustimmung zu den Worten, Handlungen und Werten, an die der Täter glaubt.
- Es gibt positive Gefühle, die vom Täter gegen das Opfer auftreten oder offen vermittelt werden.
- Das Opfer hilft dem Täter wissentlich und freiwillig, selbst ein Verbrechen zu begehen.
- Sie möchten sich nicht an den Bemühungen zur Freilassung oder Rettung von Opfern des Täters beteiligen oder daran beteiligt sein.
In einigen Fällen kann das Opfer sogar eine emotionale Nähe zum Täter spüren. Die intensive Interaktion und Kommunikation zwischen dem Täter und dem Opfer, die normalerweise isoliert sind, kann das Opfer dazu bringen, die Ähnlichkeit mit dem Täter zu erkennen, sei es sozial, emotional oder psychologisch. Nun, von dort aus kann das Opfer Mitleid und Sympathie für den Täter erzeugen, sogar Zuneigung.
Rehabilitationsbemühungen für Menschen mit Stockholm-Syndrom
Die gute Nachricht ist, dass sich Menschen mit Stockholm-Syndrom erholen können, obwohl dies nicht über Nacht möglich ist. Normalerweise rät das medizinische Team zusammen mit einem Psychologen dem Opfer, sich einer Rehabilitation zu unterziehen.
Die Dauer der Rehabilitationsphase variiert von Person zu Person, da dies davon abhängt, wie stark die Beziehung zum Täter ist und ob das Opfer noch mit dem Täter kommuniziert.
Wie bei den meisten Fällen schwerer Traumata müssen ein unterstützender Ansatz und eine Psychotherapie befolgt werden. Achten Sie auch auf die Unterstützung Ihrer Familie oder Ihrer nächsten Verwandten. Besonders wenn das Opfer Komplikationen wie Depressionen hat.
Die moralische Unterstützung durch die dem Opfer am nächsten stehenden Personen kann den Rehabilitationsprozess optimaler gestalten, sodass auch die Chance des Opfers, sich schnell von diesem Syndrom zu erholen, größer wird.